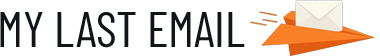Es gibt eine große Anzahl Christen, die das jüdische Posaunenfest (Rosch ha-Schana) als Zeitpunkt für die Entrückung sehen. Im Folgenden wird die Argumentation beleuchtet, am Schluss aber auch die Argumente der Kritiker dieser Theorie genannt.
Teil I: Das Fundament der Argumentation – Biblische Lehren zur Entrückung
Die Lehre von der Entrückung stützt sich primär auf zwei zentrale Passagen in den Briefen des Apostels Paulus. Diese Texte bilden das unumgängliche Fundament, auf dem jede Theorie über den Zeitpunkt und die Art dieses Ereignisses aufbauen muss.
A. Die Verheißung der Entrückung in 1. Thessalonicher 4,13-18
Im ersten Brief an die Thessalonicher wendet sich Paulus einer seelsorgerlichen Frage zu: dem Schicksal jener Gläubigen, die bereits vor der Wiederkunft Christi gestorben sind. Seine Absicht ist es, Trost zu spenden und eine Hoffnung zu vermitteln, die über den Tod hinausgeht. Paulus verwendet hierfür den Euphemismus der „Entschlafenen“, um den Tod für Gläubige als einen temporären Zustand zu charakterisieren, aus dem sie durch Christus erweckt werden.
Die von Paulus beschriebene Sequenz der Ereignisse ist präzise und dramatisch:
- Die persönliche Rückkehr Christi: „Der Herr selbst“ wird vom Himmel herabkommen. Es wird kein Stellvertreter oder Engel gesandt, sondern Christus persönlich holt seine Gemeinde heim.
- Die akustischen Signale: Dieses Kommen wird von drei gewaltigen Klängen begleitet: einem „gebietenden Zuruf“ (einem Befehl, vergleichbar mit dem Ruf, der Lazarus aus dem Grab rief), der „Stimme des Erzengels“ und dem Schall der „Posaune Gottes“. Diese Beschreibung deutet auf ein lautes, unüberhörbares und autoritatives Ereignis hin.
- Die Auferstehung der Toten: Die „in Christus Verstorbenen“ werden zuerst auferweckt. Sie haben keinen Nachteil gegenüber den Lebenden, sondern werden ihnen sogar vorangehen.
- Die Entrückung der Lebenden: Unmittelbar danach werden die zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen zusammen mit den Auferstandenen „entrückt“ werden. Das hier verwendete griechische Wort harpazō bedeutet „wegreißen“, „gewaltsam ergreifen“ oder „wegschnappen“. Dieses Ereignis wird als ein plötzliches und kraftvolles Eingreifen Gottes beschrieben.
- Der Treffpunkt und das Ziel: Die Vereinigung findet „in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft“ statt. Das ultimative Ziel ist die ewige und ununterbrochene Gemeinschaft mit Christus: „und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein“.
B. Das Geheimnis der Verwandlung in 1. Korinther 15,50-55
Während der Thessalonicherbrief den Ablauf der Entrückung beschreibt, legt der erste Korintherbrief den Fokus auf die notwendige körperliche Veränderung, die damit einhergeht. Paulus enthüllt hier ein „Geheimnis“ (griech. mysterion), eine Wahrheit, die zuvor im Alten Testament nicht offenbart war. Er erklärt, dass „Fleisch und Blut“, also der sterbliche menschliche Körper, das Reich Gottes nicht erben können. Daher ist eine radikale Verwandlung erforderlich.
Dieser Text liefert zwei entscheidende Details für die Theorie des Posaunenfestes:
- Der Zeitpunkt: Die Verwandlung geschieht augenblicklich, „in einem Nu, in einem Augenblick“. Es handelt sich nicht um einen Prozess, sondern um ein punktuelles, plötzliches Ereignis.
- Der prophetische Auslöser: Dieser Moment wird durch die Phrase „bei der letzten Posaune“ (griech. en tē eschatē salpingi) eingeleitet. Diese Formulierung ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Argumentation.
Das Ergebnis dieses Ereignisses ist der endgültige Sieg über den Tod. Die Toten werden in Unverweslichkeit auferweckt, und die Lebenden werden verwandelt, sodass der Tod seine Macht verliert.
Die Ambiguität des Begriffs „letzte Posaune“ ist dabei von entscheidender Bedeutung. Paulus definiert nicht, wovon diese Posaune die „letzte“ ist. Ist es die letzte Posaune der Weltgeschichte? Die letzte in einer Serie von Gerichtsposaunen, wie sie später in der Offenbarung beschrieben werden? Oder die letzte Posaune eines bestimmten, den Adressaten bekannten Rituals? Diese exegetische Unklarheit schafft den notwendigen Interpretationsspielraum. Während einige Theologen eine Verbindung zu den Posaunengerichten der Offenbarung herstellen , lehnen andere dies ab und suchen nach einer alternativen Erklärung. Die Theorie der Entrückung am Posaunenfest füllt genau dieses Vakuum, indem sie eine plausible Verbindung zu einem alttestamentlichen Fest anbietet, das ebenfalls durch Posaunenschall definiert ist. Die Unbestimmtheit des biblischen Textes wird so zur Voraussetzung für die Entwicklung dieser spezifischen typologischen Deutung.
Teil II: Der prophetische Schlüssel – Das Posaunenfest (Rosch ha-Schana)
Um die Verbindung zwischen der „letzten Posaune“ und der Entrückung zu verstehen, ist eine Analyse des jüdischen Posaunenfestes, Rosch ha-Schana, unerlässlich. Dieses Fest ist mehr als nur das jüdische Neujahr; es ist reich an Symbolik, die von den Befürwortern der Theorie als prophetische Vorabbildung des Entrückungsereignisses gedeutet wird.
A. Biblischer Ursprung und Anordnung
Das Fest ist in der Tora im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Verse 24-25, als ein „Gedenktag mit Posaunenschall“ (Zichron Teru’a) und im vierten Buch Mose, Kapitel 29, Vers 1, als ein „Tag des Posaunenschalls“ (Yom Teru’a) eingesetzt. Es findet am ersten Tag des siebten Monats des jüdischen Kalenders (Tischri) statt und leitet die zehntägige Periode der Buße und Selbstprüfung ein, die sogenannten „ehrfurchtsvollen Tage“, die im Großen Versöhnungstag (Jom Kippur) gipfeln.
B. Der Schofar: Instrument und Symbolik
Das zentrale Element des Festes ist nicht die metallene Posaune, wie sie im modernen Orchester bekannt ist, sondern der Schofar – ein meist aus einem Widderhorn gefertigtes, uraltes liturgisches Blasinstrument. Seine durchdringenden, archaischen Klänge sind keine Melodien, sondern Signale, die eine Reihe spezifischer Bedeutungen tragen. Die wichtigsten Tonfolgen sind die
Teki’a (ein langer, ununterbrochener Ton), die Schewarim (drei gebrochene Töne) und die Teru’a (neun oder mehr kurze, stakkatoartige Töne). Der Gottesdienst erreicht seinen Höhepunkt mit dem Teki’a Gedola, einem sehr langen, gehaltenen Ton, der als „der große Stoß“ bekannt ist.
Die jüdische Tradition schreibt dem Schofar eine vielschichtige Symbolik zu, die für die christliche Deutung von entscheidender Bedeutung ist:
- Krönung Gottes als König: Der Schofarklang wird mit den Trompetenstößen bei der Inthronisierung eines Königs verglichen. An Rosch ha-Schana wird Gott als Schöpfer und souveräner Herrscher der Welt anerkannt und gefeiert.
- Ruf zur Umkehr (Teschuwa): Der alarmierende Klang soll die Herzen und das Gewissen der Menschen „wachrütteln“, sie zur Besinnung bringen und zur Buße für ihre Sünden aufrufen.
- Erinnerung an die Offenbarung am Sinai: Die Übergabe der Tora an Mose am Berg Sinai wurde von mächtigen Schofarklängen begleitet (2. Mose 19,16-19), was die göttliche Autorität des Gesetzes unterstreicht.
- Erinnerung an die Bindung Isaaks (Akedah): Das Widderhorn erinnert untrennbar an den Widder, der sich im Gestrüpp verfing und von Abraham anstelle seines Sohnes Isaak geopfert wurde (1. Mose 22). Es ist ein starkes Symbol für stellvertretende Sühne, unerschütterlichen Glauben und Gottes Versorgung.
- Prophetische Ankündigung: In der jüdischen Eschatologie wird der Schall eines großen Schofars das Kommen des Messias ankündigen und die Sammlung der Zerstreuten Israels einleiten. Er ist zudem untrennbar mit der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten am Tag des Gerichts verbunden.
Ein entscheidender, oft übersehener Faktor, der die Theorie für ein christliches Publikum besonders zugänglich macht, ist die semantische Verschiebung, die durch Bibelübersetzungen, insbesondere die von Martin Luther, stattgefunden hat. Das hebräische Wort Schofar wurde im Deutschen konsequent mit Posaune wiedergegeben. So wurden die „Schofarot von Jericho“ zu den „Posaunen von Jericho“. Diese sprachliche Brücke lässt die Verbindung zwischen dem alttestamentlichen rituellen Widderhorn und dem neutestamentlichen Posaunenruf, der bei der Entrückung ertönt, als direkter und selbstverständlicher erscheinen, als es die ursprünglichen Begriffe vielleicht suggerieren. Diese Übersetzungstradition ist ein wichtiger Katalysator, der die typologische Verknüpfung für viele Gläubige plausibel macht.
Teil III: Die Synthese – Die Verbindung von Posaunenfest und Entrückung
Die Theorie, dass die Entrückung am Posaunenfest stattfindet, entsteht durch eine bewusste Synthese der neutestamentlichen Verheißungen mit der Symbolik des jüdischen Festkalenders. Sie basiert auf zwei Hauptpfeilern: der spezifischen Deutung der „letzten Posaune“ und der Einbettung dieses Ereignisses in ein größeres prophetisches Muster der Feste Israels.
A. Die Deutung der „letzten Posaune“: Der Kern der Argumentation
Der zentrale Anspruch der Theorie ist, dass die „letzte Posaune“ aus 1. Korinther 15,52 nicht mit der siebten Gerichtsposaune aus Offenbarung 11 identisch ist. Befürworter dieser Sichtweise lehnen eine solche Gleichsetzung aus mehreren gewichtigen Gründen ab:
- Chronologischer Widerspruch: Der erste Korintherbrief wurde um 55 n. Chr. verfasst, während die Offenbarung des Johannes erst Jahrzehnte später (ca. 68 n. Chr. oder sogar nach 90 n. Chr.) entstand. Es ist historisch unplausibel, dass Paulus sich auf die Symbolik eines Buches bezog, das zu seiner Zeit noch gar nicht geschrieben war.
- Funktionaler Unterschied: Die Posaune bei Paulus kündigt ein Ereignis der Gnade an: die Auferstehung der Toten und die Verwandlung und Sammlung der Gläubigen. Die sieben Posaunen der Offenbarung hingegen sind Signale für schreckliche Gerichte, die über eine gottlose Welt kommen – Ereignisse des Zorns Gottes, nicht der Erlösung der Gemeinde.
Nachdem die Verbindung zur Offenbarung verworfen wurde, wird eine alternative Identifikation vorgeschlagen: Die „letzte Posaune“ ist eine direkte Anspielung auf den Teki’a Gedola – den letzten, langen und kulminierenden Schofar-Stoß des Rosch ha-Schana-Gottesdienstes. In der jüdischen Symbolik stand dieser letzte Ton für die Sammlung des Volkes und den Aufbruch. Ein ähnliches Bild findet sich in der Beschreibung des Aufbruchs eines römischen Heeres, bei dem die letzte Posaune das Signal zum Marsch war – ein Bild, das Paulus‘ Publikum ebenfalls verstanden haben könnte. Die Annahme ist, dass die Korinther, die in einer von jüdischer Kultur beeinflussten Welt lebten, diese Anspielung auf das Posaunenfest verstanden.
B. Das prophetische Muster der Feste Israels
Die Argumentation gewinnt an Überzeugungskraft, indem sie in einen größeren typologischen Rahmen gestellt wird. Die sieben in 3. Mose 23 aufgelisteten Feste Israels werden nicht nur als historische Gedenktage, sondern als ein von Gott gegebener prophetischer Fahrplan für die gesamte Heilsgeschichte interpretiert. Dieses Muster wird in zwei Phasen unterteilt: die bereits erfüllten Frühlingsfeste und die noch unerfüllten Herbstfeste.
Die erfüllten Frühlingsfeste (Christi erstes Kommen):
- Passah: Findet seine Erfüllung in der Kreuzigung Jesu, der als das makellose „Lamm Gottes“ für die Sünden der Welt starb.
- Fest der ungesäuerten Brote: Symbolisiert den sündlosen Leib Christi, der im Grab lag.
- Fest der Erstlingsfrüchte: Wurde am Tag der Auferstehung Jesu erfüllt, der als der „Erstling der Entschlafenen“ bezeichnet wird und damit die Verheißung einer zukünftigen Auferstehung für alle Gläubigen garantiert.
- Wochenfest (Pfingsten): Erfüllte sich exakt 50 Tage nach der Auferstehung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gründung der Gemeinde.
Da die ersten vier Feste in chronologischer Reihenfolge und mit präziser prophetischer Entsprechung durch die Ereignisse des ersten Kommens Christi erfüllt wurden, entsteht eine starke Erwartungshaltung, dass die verbleibenden drei Herbstfeste in ähnlicher Weise die Ereignisse rund um sein zweites Kommen vorhersagen.
Die postulierten unerfüllten Herbstfeste (Ereignisse um Christi Wiederkunft): 5. Posaunenfest (Rosch ha-Schana): Wird als prophetischer Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde gedeutet – die Sammlung der Gläubigen durch den Posaunenruf Gottes.
6. Versöhnungstag (Jom Kippur): Wird als Symbol für die nationale Buße und Bekehrung Israels am Ende der großen Trübsal gesehen, wenn sie auf den blicken, den sie durchstochen haben (Sacharja 12,10). 7. Laubhüttenfest (Sukkot): Wird als prophetisches Bild für das Tausendjährige Friedensreich interpretiert, wenn Christus sichtbar auf der Erde regieren und Gott „bei den Menschen wohnen“ wird (Offenbarung 21,3).
Die folgende Tabelle fasst dieses prophetische Deutungsschema zusammen und verdeutlicht die logische Progression, die der Theorie zugrunde liegt.
C. Zusammenführung der Symbole
Die Theorie erreicht ihren Höhepunkt in der direkten Verknüpfung der zentralen Motive. Die Themen der Entrückungstexte – die Auferstehung der Toten, die Sammlung der Lebenden, die Plötzlichkeit des Ereignisses und der zentrale Posaunenschall – korrespondieren auffallend mit den Kernsymbolen von Rosch ha-Schana: der Ruf zur Versammlung, der Tag des Gerichts, die Krönung des Königs und die tief verwurzelte Hoffnung auf die Auferstehung der Toten beim Kommen des Messias. In dieser Synthese wird das Posaunenfest zum göttlich verordneten „Generalproben“-Fest für das zukünftige Ereignis der Entrückung.
Teil IV: Theologischer Kontext und kritische Perspektiven
Die Theorie der Entrückung am Posaunenfest ist keine isolierte exegetische Entdeckung, sondern das logische und zugespitzte Produkt eines umfassenderen theologischen Systems: des Dispensationalismus. Das Verständnis dieses Systems ist entscheidend, um die Entstehung, die Argumentationsstruktur und die Kritik an der Theorie einordnen zu können.
A. Der Dispensationalismus als theologischer Ursprung
Der Dispensationalismus ist ein hermeneutisches System zur Auslegung der Bibel, das die Heilsgeschichte in verschiedene Epochen oder „Haushaltungen“ (Dispensationen) einteilt, in denen Gott auf unterschiedliche Weise mit der Menschheit handelt. Dieses System, das im 19. Jahrhundert maßgeblich durch John Nelson Darby und die Bewegung der „Plymouth Brethren“ systematisiert wurde, basiert auf mehreren Kernlehren :
- Eine konsequent wörtliche Auslegung der Heiligen Schrift, insbesondere der biblischen Prophetie. Verheißungen, Zahlen und Ereignisbeschreibungen werden, wo immer möglich, buchstäblich verstanden.
- Eine scharfe Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde (Kirche). Israel (das irdische Volk Gottes) und die Gemeinde (das himmlische Volk Gottes) werden als zwei separate Entitäten mit unterschiedlichen Berufungen, Verheißungen und Schicksalen betrachtet. Die Gemeinde ersetzt Israel nicht (Substitutionstheologie), sondern ist eine Art „Einschub“ im Heilsplan Gottes.
- Die Lehre der Entrückung vor der Trübsal (Prä-Tribulationismus). Aus der Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde folgt die Notwendigkeit, die Gemeinde vor Beginn der siebenjährigen „Trübsalszeit“ von der Erde zu entfernen. Diese Zeit des Gerichts gilt nach dispensationalistischer Auffassung primär dem ungläubigen Teil der Welt und der Läuterung des Volkes Israel, nicht der Gemeinde, der die Bewahrung vor dem Zorn verheißen ist.
Die Lehre von einer „geheimen“ Entrückung, die zeitlich von der späteren, sichtbaren Wiederkunft Christi zur Errichtung seines Reiches getrennt ist, ist eine relativ neue theologische Entwicklung. Sie schafft die theologische Notwendigkeit, nach einem spezifischen Zeitpunkt für dieses erste Ereignis zu suchen. Die Posaunenfest-Theorie ist die Antwort auf diese systemimmanente Frage. Sie ist nicht das Ergebnis einer reinen Textauslegung, sondern die Anwendung eines vorab festgelegten theologischen Systems auf den biblischen Text, um eine Lücke im „prophetischen Fahrplan“ zu füllen.
B. Kritik und alternative Deutungen
Die Theorie und ihr zugrundeliegendes System sind Gegenstand erheblicher theologischer Kritik aus verschiedenen Richtungen.
- Historische Kritik: Der Prä-Tribulationismus und die damit verbundene Idee einer zeitlich getrennten, geheimen Entrückung sind keine Lehren der alten Kirche oder der Reformatoren. Kritiker argumentieren, es sei unwahrscheinlich, dass eine so zentrale eschatologische Wahrheit 1800 Jahre lang von der Kirche übersehen wurde, um erst im 19. Jahrhundert „wiederentdeckt“ zu werden.
- Exegetische Kritik:
- Die Verbindung der „letzten Posaune“ mit dem Posaunenfest ist eine unbewiesene Annahme. Es handelt sich um eine Form der Eisegese (das Hineinlesen einer Bedeutung in den Text), da der Kontext in 1. Korinther 15 keinerlei Hinweis auf ein jüdisches Fest enthält. Die Verbindung ist spekulativ und nicht durch direkte biblische Aussagen gestützt.
- Die Vorstellung einer „geheimen“ Entrückung steht im Widerspruch zur Beschreibung in 1. Thessalonicher 4, die ein lautes, für alle Betroffenen deutlich wahrnehmbares Ereignis schildert („gebietender Zuruf“, „Stimme des Erzengels“, „Posaune Gottes“).
- Einige Kritiker lehnen die gesamte Entrückungslehre ab, da sie der biblischen Aussage über die Universalität des physischen Todes (Hebräer 9,27) zu widersprechen scheint.
- Theologische Kritik:
- Der Dispensationalismus wird für seine teils willkürlich erscheinende Einteilung der Heilsgeschichte und die Tendenz kritisiert, die Gültigkeit und Relevanz des Alten Testaments für Christen herabzusetzen.
- Die Erwartung einer Flucht vor der Trübsal kann eine Haltung der „Realitätsflucht“ fördern und das biblische Zeugnis des standhaften Ausharrens im Leiden untergraben. Die Bibel lehrt an zahlreichen Stellen, dass Gläubige durch Trübsal gehen und darin bewahrt, nicht aber davor bewahrt werden.
- Alternative Deutung der „letzten Posaune“: Es gibt andere plausible Erklärungen für den Begriff. Er könnte sich auf ein römisches Militärsignal beziehen, das den Aufbruch des Lagers ankündigte – ein verständliches Bild für die Sammlung und den Aufbruch der Gemeinde. Alternativ könnte es sich einfach um die „Posaune Gottes“ handeln, die das endzeitliche Handeln Gottes einleitet, ohne eine spezifische Verbindung zu einem Fest oder einer nummerierten Serie von Posaunen zu haben.
Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die Theorie, die das jüdische Posaunenfest als den prophetisch vorherbestimmten Zeitpunkt der Entrückung identifiziert, ist eine komplexe und detaillierte eschatologische Konstruktion. Ihre Argumentation basiert auf einer typologischen Synthese: Die unklare neutestamentliche Erwähnung der „letzten Posaune“ in 1. Korinther 15 wird mit dem kulminierenden Schofar-Stoß (Teki’a Gedola) des Rosch ha-Schana-Festes gleichgesetzt. Gestützt wird diese Verbindung durch die Einbettung in das größere prophetische Muster der Feste Israels, in dem das Posaunenfest als das nächste in der Reihe der noch unerfüllten Herbstfeste positioniert wird und somit logischerweise der Entrückung entsprechen muss.
Es muss festgehalten werden, dass diese Theorie innerhalb ihres eigenen theologischen Bezugssystems – des Dispensationalismus – eine bemerkenswerte innere Kohärenz und systematische Geschlossenheit aufweist. Sie bietet eine detaillierte und scheinbar biblisch verankerte Antwort auf die Frage nach dem „Wann“ der Entrückung, die viele Gläubige beschäftigt.
Gleichwohl handelt es sich um ein spezifisches Interpretationsmodell, das maßgeblich von den Axiomen des Dispensationalismus abhängt und keine universell anerkannte Lehre innerhalb der christlichen Theologie darstellt. Kritiker weisen auf die junge historische Herkunft der Lehre, exegetische Schwächen in der Verknüpfung der Schlüsseltexte und theologische Bedenken hinsichtlich einer möglichen „Realitätsflucht“ hin. Über alle theologischen Differenzen bezüglich der Endzeit hinweg bleibt der einhellige Appell der neutestamentlichen Schriften bestehen: Er zielt nicht auf die präzise Berechnung von Daten und Zeitplänen, sondern auf eine Haltung der geistlichen Wachsamkeit, der beständigen Hoffnung und der praktischen Bereitschaft für die jederzeit mögliche Wiederkunft Jesu Christi.